
Stall: Lüftung
Januar 2005
Klaus
Auf eine Bitte hin probiere ich die Thematik über die Hühnerstalllüftung zusammen zufassen. Leider oder für einige Personen auch Gott sei dank, werde ich nur wenig auf Formeln, technische Details oder Größen eingehen können, da ich nicht auf die Ausbildung eines Dipl.-Ing., Techniker oder Lüftungsbauermeister zurückgreifen kann. Ich probiere daher lediglich, die Lüftung leichtverständlich, mit dem von mir angeeigneten Wissen zu erklären, was ja eigentlich schon überall im Web, aber leider oft nur bruchstückhaft, zu finden ist.
Warum wir gewissenhaft lüften und dies aus gesundheitsrelevanten Gründen nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten.
Hier ein paar Infos über die Inhaltsstoffe der Stallabluft:
Kurz gesagt: Staub (unbelebte Partikel aus nicht vermehrungsfähigen Mikroorganismen), belebt Staub (vermehrungsfähige Mikroorganismen wie Bakterien und Viren), Keime, Pilze wie deren Zerfallsprodukte (Endotoxine), die sich allesamt z.B. aus abgelösten Körperteilchen der Hühner, Einstreu, Futter, Trinkwasser und den Fäkalien bilden, sich in die feuchtwarme Luft einbinden und sich vermehren. Die Luft funktioniert so auch als Kontaminationsträger, was sich besonders im Sommer, oder in erwärmten Ställen, zu einen biologischen aktiven Aerosol entwickelt, was in den Lungen der Hühner zu Beeinträchtigungen führen kann. Nicht zu vergessen die Schadgase, deren kohlenstoffhaltige Verbindungen aus dem Hühnerkot (Ammoniak), der Ausatmung der Hühner (Stickstoffoxide, Kohlendioxide, Methan) entstehen. Gott sei Dank konnte ich bisher auf solche Erfahrungen verzichten.
Es sind also einige gewichtige Gründe, um sich über eine vernünftig funktionierende Lüftung Gedanken zu machen. Wie weit für wen all diese Eventualitäten, wie Infektionsdruck durch Überbesatz im Stall, oder deren Verschmutzung in Betracht kommen, vermag ich nicht zu sagen, da ich eure Stallungen nicht kenne.
Ich denke, mit der öfter mal "im Winter kurz Fenster auf und wieder zu Methode" ist es nicht getan und besonders in der Nacht nicht, wo sich alle Hühner im gänzlich verschlossenen Stall befinden. Oberhalb des meist in der Nacht verschlossenen Fensters bilden sich Todzonen, aus dessen Teil des Raumes die Luft nur schwer oder gar nicht abziehen kann. An den oberen Stellen der Wand, der Decke und in den Ecken, bildet die sich abkühlende feuchtwarme Luft eine Kondensfeuchte die sich dort niederschlägt, was die Basis für Schimmelbildung ist. Es ist daher wichtig, Todzonen - man könnte sie auch Luftsäcke oder Kuppeln nennen - zu vermeiden oder in diese Todzonen hinein einen extra Luftausgang über Dach zu führen.
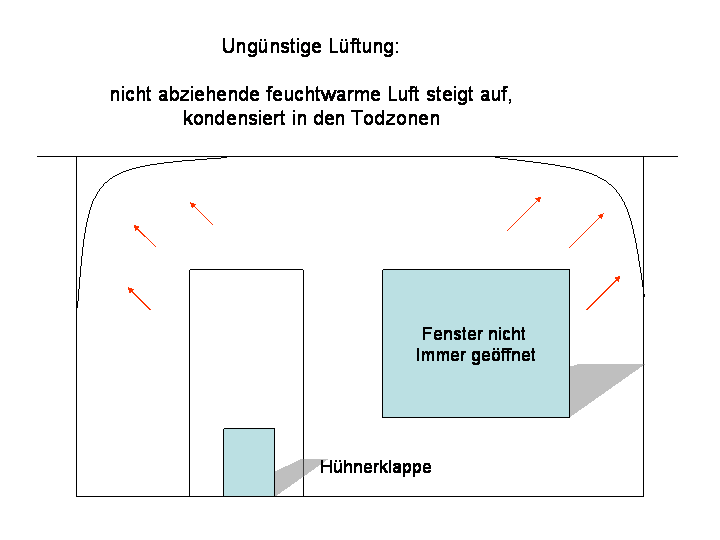
Die Hühner brauchen konstant trockene relativ "kühle"
Luft, und das funktioniert sehr gut mit der natürlichen Schwerkraftlüftung.
Sie ist die "normale" freie Lüftung, durch Fenster, Türen,
Lüftungsschächte, sowie Lüftungslöcher und der Trauf-Firstöffnungen.
Sie beruht auf der Sogwirkung, also auf Unterdruck. Die Funktionsweise
der Schwerkraftlüftung wird begünstigt durch die Körperwärme
der Hühner, die auf Grund der geringeren Dichte, der wärmeren
"leichteren" Luft, im Stall zur Decke steigt. Die dadurch im
Stall nachrückende "schwerere" kältere Luft wird durch
die Lufteingänge nachgesogen und fällt anschließend zum
Boden.
Man merke: man kann immer nur soviel Luft aus dem Raum heraus lassen, wie man anders wo wieder herein lässt. Also niemals ein einzelnes kleines Lüftungsloch, auf halber Höhe in den Raum, das funktioniert nicht. Immer mindestens zwei Lüftungslöcher anbringen, das tiefer gelegene als Lufteingang, das am höchsten Punkt als Luftausgang. Dazu eignen sich am besten Decken oder Dachformen, die nicht waagerecht sind, sondern zu einer Seite hin ansteigen, wie z.B. das Pult- oder Satteldach.
Man muss sich das so vorstellen: Abwasserrohre brauchen stets ein bestimmtes
Gefälle nach unten, um ablaufen zu können. Logisch. Bei Schwerkraftlüftungen
ist es genau umgekehrt, die Luft sollte überall ungehindert aufsteigen
können, ohne in Luftkuppeln abgefangen und angestaut zu werden.
Grundsätzlich ist die warme Luft das Transportmittel für die
Feuchtigkeit. Umso wärmer die Luft ist, umso höher ist der Sättigungsgrad,
um die Feuchtigkeit in ihr aufzunehmen, die dann allerdings auch mit einer
gut funktionierenden Schwerkraftlüftung ins Freie abtransportiert
werden sollte. Beschlagene Fenster und feuchte Decken oder Wände
sind meist ein sicherer Hinweis dafür, dass die im Stall angestaute
Feuchtigkeit durch eine ungünstige Lüftung hervorgerufen wurde.
Es kann aber auch mal passieren, dass ein Stall durch saumäßiges
Regenwetter (nasse Hühner rein und raus aus dem Stall) "absäuft",
was auch von den mehr oder weniger diffusionsoffenen Materialien des Stalls
abhängt. In diesem Fall würde ich einfach mal eine extra Wärmequelle,
z.B. einen Propangasbrenner oder einen Bauscheinwerfer zum Trockenlegen
des Stalls reinstellen. Natürlich ohne das die Hühner im Stall
sind!
Bei der Trauf - First Lüftung (unteres Bild) sind die Lüftungsein- und Ausgänge zwischen den Sparren, über die gesamte Stalllänge möglich. Blaue Pfeile -> kalte Luft, rote Pfeile -> warme Luft.
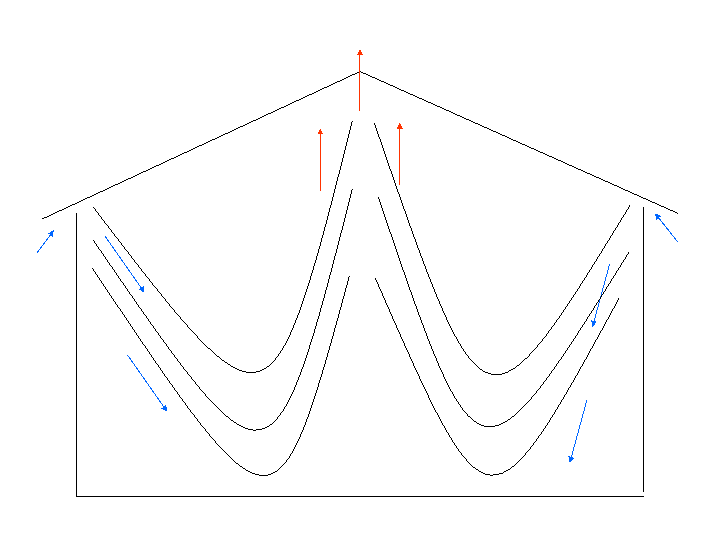
Im Punkto Isolierung des Stalls wird der Sinn meines Erachtens oft verkannt.
Habe ich eine ausreichende Wärmemenge, die von den Hühnern ausgeht
- also das Verhältnis der Besatzdichte zum Raumvolumen - werde ich
immer eine günstige Temperaturdifferenz zwischen Außen- und
Innentemperatur erreichen, um die Auftriebskräfte der wärmeren
verbrauchten Luft zu verstärken.
Man sollte sich daher überlegen, ob man bei niedrigen Wärmemengen,
ermittelt aus den Q wert sensibel =Spezifische Wärmemenge der Hühner
- zum Raumvolumenverhältnis, also weniger Hühner - größerer
Stall, nicht doch lieber auf eine Isolierung zurückgreift, denn bei
fast identischer kühler Außen- und Innentemperatur, findet
kaum noch ein Luftaustausch statt, weswegen die kontaminierte Raumluft
im Stall still steht.
So, nun gilt es nur noch, die strömungstechnischen Vorgänge der Luft zu optimieren. Dabei spielt auch Grundsätzliches eine Rolle. Um Zugluft zu vermeiden, dürfen die Hühner den Luftströmungen nicht direkt ausgesetzt sein. Also sollte man nie direkt unter einen Lüftungseingang (kalte Luft) einen Schlafplatz oder ein Nest bauen.
Zum Vergleich: Stellt Euch vor euren offenen Kühlschrank, was bekommt Ihr? kalte Füße oder kalte Ohren? Klar doch, die Kälte fällt nach unten und in dem Fall auf die Hühner. Man kann die einströmende Kaltluft mittels einer Zwischendecke in den Raum rein verlagern, um die Luftströmungen von den Hühnern fern zu halten. Das hab ich wie auf dem Bild unten auch mit meinen Stall gemacht. Zwischen den Sparren, aus 4x6 cm Dachlatten, habe ich die Zwischenräume frei gelassen, so das diese 6x40 cm breiten Schlitze auf der gesamten Stallbreite als Lüftungsschlitze funktionieren. Das Kotbrett mit der darüber liegenden Schlafstange ist auf ca. 80 cm Höhe. Die Möglichkeit der Luftregulierung zwischen den Sparren besteht darin, dass man eventuell ein oder zwei Öffnungen bei extremer Kälte verschließt.
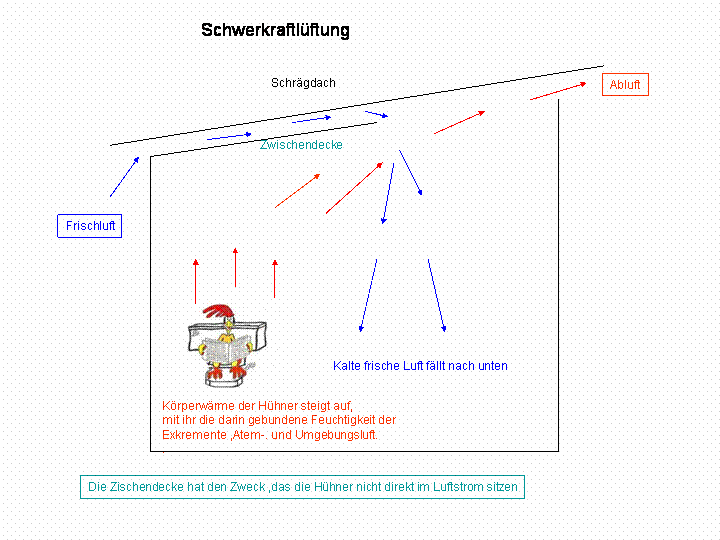
Um auch ein Gefühl für unangenehme Zugluft zu bekommen, noch
was Grundsätzliches.
Bei sehr warmen Temperaturen empfinden Hühner leichte Zugluft durchaus
als angenehm.
Das heißt, bei extremer Hitze kann man die Luft mittels eines Ventilators
in Bewegung bringen, was zwar die Temperatur nicht wesentlich herunter
kühlt, die Luftmassenbewegungen den Hühnern aber sehr angenehm
sind. Temperaturen über 45° führen bei Hühnern zum
Kollaps also zum Hitzetod.
Bei entgegen gesetzten Temperaturen, also unangenehmer Kälte bis
zum Frost hin, müssen die Luftströmungen immer mehr reduziert
werden. Denn kleinste konstante "Windchen" im Stall, die direkt
auf die Hühner prallen, können bei Frost tödliche Krankheiten
hervorrufen. Entgegen gesetzt einiger Behauptungen, "meine Ställe
ziehen Luft an allen Enden und Ecken", möchte ich behaupten,
kein Huhn setzt sich freiwillig in die Zugluft. Noch nicht mal draußen
im Freien, da suchen sich die Hühner auch lieber ein ruhiges windstilles
Plätzchen.
So jetzt kommen wir zum besten Teil, der Dimensionierung der Klappen
und Öffnungen.
Man könnte hier eine Formel hinlegen, wo mit sich garantiert alle
physikalischen Größen ausrechnen und bestimmen lassen. So wie
ich sie schon mal auf Anfrage von einem sehr freundlichen Lüftungsfachmann
erhalten habe:
Berechnung leicht gekürzt.
Die Masse eines Huhns sei 2 kg, 13 Hühner sind dann 26 kg Lebendgewicht.
Da es hier hauptsächlich um die nächtliche Belüftung des
Objektes geht, muss vom Ruhezustand der Hühner ausgegangen werden.
Als Basis diene die "Futterformel": Futter wird zu 6 CO2 + 12
H2O + 675 Kcal umgesetzt. Der Grundumsatz beträgt im Minimum 1.2
Watt je kg Lebendgewicht, also 31.2 Watt für alle, und zwar unabhängig
davon, wie sie aufgeplustert sind, wenn es kalt ist.
Die CO2 Entwicklung lässt sich aus der Futterformel dann ableiten:
macht 0.184 ltrCO2/Wh x 31.2 W = 5.74 ltr CO2 je Stunde (bei 20 °C).
Setzt man für den Hühnerstall ebenfalls den Pettenkofergrenzwert
von 1000ppm CO2 an, und eine Außenluftqualität von 400ppm,
ergibt sich ein erforderlicher Lüftungsvolumenstrom von 0.00574/(0.001-0.0004)
= 9.56 cbm/h Frischluft.
Der Hühnerstall hat eine Oberfläche von 2x2x6 = 24 qm. Unter
der Annahme einer Wandstärke von 2 cm Holz ergibt sich dann eine
Wärmedurchgangszahl von (ai=8, aa=25 W/qmK) U= 1/(1/8+1/25+0.02/0.15)
= 3.35 W/m²K, wenn das Holz eine Wärmeleitfähigkeit von
0.15 W/mK hat. Die Transmissionsverluste betragen dann 24m²x3.35
W/m²K = 80.44 W/K. Die Lüftungsverluste betragen 9.56 cbm/h
x 1000 J/kgK x 1.2 kg/m³ = 11472 J/h = 11772/3600= 3.18 W/K. Der
Gesamtverlust also (80.44+3.18) = 83.6 W/K. Wegen der inneren Wärmeentwicklung
von 31.2 W ergibt sich dann eine Innentemperatur im Hühnerstall,
welche um 31.2/83.6 = 0.37 °C über Außentemperatur liegt.
Jetzt müsste man eigentlich wissen, auf welchen Stockwerken die Hühner
schlafen: Im Erdgeschoß oder unterm Dach oder gleichmäßig
verteilt?
Der Auftrieb beträgt dann etwa 2m x 9.81 m/sek² x 1.2 kg/m³
x 1/273°C x 0.37 ^C = 0.0319 Pa. Damit ergibt sich ohne Berücksichtigung
von Reibungsverlusten und Ein/Ausströmverlusten eine Ausblasgeschwindigkeit
von (0.0319 Pa x 2/1.2) und daraus die Wurzel = 0.23 m/sek. Für die
9.56 cbm/h = 0.00265 m³/sek ergibt sich dann ein Ausströmquerschnitt
von 0.00265/0.23 = 0.0115m², also 115 cm². Rechnet man die Verluste
mit ein (dP wirk = ca 1/4 dP) ergeben sich 230cm².
Da die meisten Hobbyhühnerhalter nur kleinere Stallungen besitzen,
also für den der es Einfacher haben möchte, ein Vorschlag …von
hinten durch die Brust ins Auge: baut an den Stellen, die ihr ermittelt
habt, wie z.B. bei der Querlüftung, regulierbare Lüftungsklappen
an.

Lieber ein paar mehr als Nötig, so habt ihr je nach extremer Wetterlage die Möglichkeit die Luftstrommassen zu regeln. Zum überschlagen und zur Orientierung eurer Lüftungsverhältnisse empfiehlt man für Ställe eine Luftwechselzahl von 1-3 /h. Im Winter zu 1, im Sommer zu 3 oder mehr, klar!? Noch was zum vergleichen, der Luftmassenvolumenstrom im Stall, sollte so bei 0,1 - 0,05 Meter die Sekunde betragen, um noch im Behaglichkeitsbereich zu liegen. Sichtbar kann man Luftmassenbewegung mit Nebel oder Rauch machen, oder auch mit einer Kerze ausleuchten, dessen flatternde Flamme auf Zugluft hinweißt.
Den Umgang mit der ungesteuerten Zwangslüftung (Ventilator), also auch der Stufenschaltung, stehe ich etwas differenzierter gegenüber, da einmal fest eingestellte Motordrehzahlen, bei persönlicher Abwesenheit und wechselnden Wetter, schnell ungesund für die Hühner werden können. Empfehlenswert wäre da eine etwas aufwändige Steuerungs- und Messelektronik zur Zwangslüftung.
Ich hoffe mit meinen Beitrag konnte ich ein bisschen frischen Wind in
eure Ställe bringen.
Klaus ("Glucke")
![]()
| © huehner-info.de 2000-2023 Kontakt |
 |